„Bei einer Untertitelung laufe man immer Gefahr, das Bild zu zerstören.“ Mit diesem Einwand reagiert der Regisseur Peter Nestler auf die Kritik des Publikums der Duisburger Filmwoche an der Kommentarstimme über den Originalton in der letzten Szene seines Films „Die Nordkalotte“ (DE 1991, DF15). In dieser fast 10-minütigen Szene, die dem Protokoll1 zufolge für Nestler „eine der schönsten Aufnahme [sei], die er je gemacht habe“, sitzt eine kleine Gruppe von samischen Frauen im halbförmigen Kreis. Die frontale Kamera filmt ihre Unterhaltung in ihrer Muttersprache, dann beginnen sie zu singen und schließlich zu tanzen. Über den Stimmen der Frauen und an der Stelle einer Untertitelung ertönt die männliche (für einige Zuschauer:innen „behäbige“) Off-Stimme des Narrators, die – wie im übrigen Film – Teile der Gespräche zwischen den Frauen und des Gesangs wiedergibt.
Für die damaligen Zuschauer:innen störe aber diese Off-Stimme über den Gesang „die Intensität nachhaltig“. Ein weiteres Problem besteht aber meines Erachtens in der Opazität der Entscheidungen darüber, was übersetzt und was nicht übersetzt werden soll. Denn der erklärende Kommentar verdeckt die Tatsache, dass als Resultat einer auktorialen Entscheidung eben nicht alles übersetzt wurde.
Die Frage der Untertitelung wurde mit Nestlers Films nicht zum ersten Mal Thema der Duisburger Filmwoche.
Schon bei der Vorführung von „Emigration“ (DE/CH 1979, DF3) von Nino Jacusso wurde zum Beispiel bereits über die Verwendung beziehungsweise den Verzicht auf jegliche Übersetzung in einer Szene des Dokumentarfilms ausführlich diskutiert, hier allerdings eher positiv. Es ging um die Szene, in der die Eltern des Regisseurs sich am Küchentisch in ihrer Muttersprache, Italienisch, unterhalten. Für die (meisten) damaligen Zuschauer:innen vermittelte die nicht übersetzte Szene die Erfahrung, „in die Rolle des Fremden, des Nicht-Zugelassenen gebracht“ zu werden, wodurch das Fremdsein „sinnlich“ erlebbar wurde. Der Verzicht auf Untertitel kann jedoch auch kritisch gewertet werden, wie beispielsweise im Dokumentarfilm „Noras Namibia“ (DE 1986, DF9) von Norbert Bunge. Seine Entscheidung, die Gespräche mit den schwarzen Protagonist:innen im Film nicht zu übersetzen, begründete der Regisseur dem Protokoll zufolge so, dass „sie nichts Nennenswertes beinhalten“. Außerdem wäre laut Bunge „die Untertitelung zu teuer gewesen“ und „er [habe] zeigen wollen, daß auf der Farm verschiedene Sprachen gesprochen werden“.
Der Verzicht auf eine Übersetzung führt aber dazu, dass lediglich die Perspektive des weißen Protagonisten nachvollziehbar bleibt und die anderen Sprachen bloß exotisch wirken. Aus diesen Gründen wurde diese auktoriale Entscheidung vom Publikum schon damals als stark koloniale Geste gewertet.
Obwohl diese drei Dokumentarfilme unterschiedlich mit der Frage der Mehrsprachigkeit umgehen, ist ihnen gemeinsam, dass die Untertitel grundsätzlich als ein bildfremdes Element betrachtet werden. Rein technisch gesehen trifft dies bis in die 2000er Jahre tatsächlich zu. Denn Untertitel für Kinofilme wurden zunächst separat angefertigt und erst in einem zweiten Schritt in das Bild eingefügt. Außerdem stellten sie aufgrund des aufwendigen chemischen Prozesses bis in die 1980er Jahre eine relative Gefahr für die Filme dar.2 Die computerbasierte Untertitelung, die sich ab Ende der 1980er Jahre verbreitete, und später auch die Entwicklung von Streaming-Plattformen wie YouTube, veränderten die Produktionsweise von Untertiteln, welche progressiv einfacher wurde und sich dadurch demokratisierte.3
Dass aber diese Entwicklung wiederum zu einem neuen Verständnis der Funktion von Untertiteln geführt hat, haben einige Filme in den letzten Jahren überzeugend gezeigt, wie ich im Folgenden ausführen möchte. In diesen Filmen brechen die Untertitel nämlich mit ihrer klassischen Funktion einer objektiven, jedoch mangelhaften und anti-ästhetischen Form der Übersetzung, und fungieren vielmehr als eigenständige Komponente des Bildes und als subjektive, situierte Stimme. Eine Funktion, die an die früheren Praktiken der Filmvermittlung in der Stummfilmzeit erinnert, wie z.B. die Benshis in Japan und die Filmerzähler:innen in Europa, die nicht nur die Zwischentitel während der Aufführung live für das Publikum übersetzten, sondern auch auf bestimmte Elemente hinwiesen, kulturelle Besonderheiten kommentierten und die Filme interpretierten. Zwar erfolgte diese Arbeit durch die gesprochene Sprache, aber sie zielte nicht darauf ab, die sprachlich-kulturellen Verschiebungen zu verbergen, ganz im Gegenteil: Sie lenkte die Aufmerksamkeit auf die Zirkulation der Filme innerhalb verschiedener kultureller Kontexte.
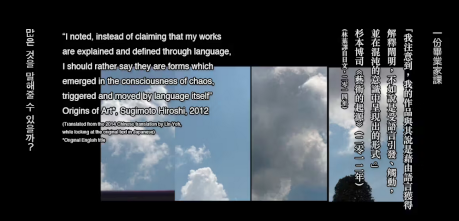
In einer Radikalisierung der sinnlichen und subjektiven Fremdheitserfahrung, die „Emigration“ erfahrbar machte, konfrontierte der experimentell und tagebuchartigen Film „Uma ficção inútil – 小說無用 – tiểu thuyết vô dụng“ von Cheong Kin Man (DE/MO 2014, DF 39) die Zuschauer:innen mit Überforderung und Unmöglichkeit der Kommunikation. Dabei wird nicht auf Übersetzung verzichtet, sondern im Gegenteil mit einer Vielzahl von Sprachen und Schriftformen gearbeitet, die zum Hauptthema und -motiv des Films werden.
Der nicht linear aufgebaute Film kombiniert Bildmotive mit einem dichten textuellen Gewebe. Dieses besteht aus verschiedenen Untertitelspuren, Zitaten, Zwischentiteln und Bildlegenden in Englisch, Koreanisch, Japanisch, Kantonesisch, Burmesisch, Vietnamesisch, Portugiesisch, Deutsch und Französisch. Die Textformen werden oft gleichzeitig in verschiedenen Richtungen (die asiatischen Schriftsprachen vertikal und die westlichen Sprachen horizontal) und an verschiedenen Stellen (unten mittig, oben rechts und links) im Bild eingeblendet.
Ob die Untertitel bei den verschiedenen Sprachen jeweils Übersetzungen sind, ist unklar. Außerdem verselbständigen sich die Untertitel im Laufe des Films, als das Voice-Over verstummt. Die Bildmotive aus dem Alltag des Regisseurs, wie z.B. die zerstückelten Bilder eines Baums und einer Straße, wirken durch die Verwendung von Splitscreens und die verschiedenen Perspektiven in ihrer Bruchstückhaftigkeit ebenfalls wie Satzsyntagma. Im Protokoll zum Film spricht deshalb Joachim Schätz von einer „grafischen Oberfläche“, „auf der er [der Regisseur] das Material ausbreiten könne, um dort nach kulturellen Gemeinsamkeiten zu suchen.“ Diese subjektive Sammlung an Sprachformen trifft auf die subjektive Erfahrung der Zuschauer:innen, die, so der Eindruck einer Frau aus dem Publikum, „wählen müsse[n], was [sie] sehen wolle[n] und so [ihren] eigenen Film zusammenstelle[n]“. Interessanterweise fungiert, wie im Protokoll angemerkt, „der Untertitel [als] die Hauptsprache, um den Film zu verstehen“.

Für ihren Film „Vlog #8998 – Korean Karottenkuchen & Our Makeup Routine“ (DE 2021, DF46) hat die Regisseurin Ji Su Kang-Gatto ebenfalls die Form des Tagebuchs gewählt. Alternierend zwischen Sequenzen, in denen sie im Voice-Over anhand von alten Familienfotos die Geschichte ihrer Familie zwischen Deutschland und Südkorea erzählt, und Sequenzen, in denen sie mit ihrer Schwester Ji Hoe spaziert, reist oder in Kaffees isst, beschäftigt sich der Film mit dem Thema der Mehrsprachigkeit und Interkulturalität, sowie mit dem steigenden Rassismus in Deutschland.
In den meisten Szenen wird nicht explizit gesagt, wo sie sich gerade befinden, aber der Ort lässt sich aus dem Bild ableiten. Beim Sprechen wechseln die zwei Frauen zwischen Deutsch und Koreanisch, im Bild sind aber immer mindestens zwei Untertitelspuren zu sehen, eine Spur in Englisch und eine Spur auf Deutsch oder Koreanisch, je nachdem, welche Sprache gerade gesprochen wird. Dabei spielen die Untertitel eine wesentliche Rolle, die sich nicht auf die bloße Übersetzung des Gesprochen beschränkt. In der gleichzeitigen Einblendung zweier Untertitelspuren wird bildlich auf einseitige Übersetzung und Einsprachigkeit verzichtet, zugunsten der Interkulturalität, der Mehrsprachigkeit und des subjektiven Weltbezugs. Denn zusätzlich zu den farbigen Untertiteln, die an die Tradition der Untertitelung von Animes erinnern, ist das Video durchströmt von koreanischen Onomatopoesien, die den klassischen Bereich der Untertitel im unteren Teil des Bilds verlassen und den Rhythmus von den Szenen, insbesondere in den Essszenen, verändern.
Diese Funktion des Untertitels als subjektiver Kommentar und nicht nur bloß als vermeintlich ‚neutrale‘ Informationsebene lässt sich ebenfalls im 29-minütigen Film „Diva“ von Nicolas Cilins (CH 2022 DF22) beobachten. Der Film besteht aus einer kuratierten Montage von Aufnahmen über das Leben der vietnamesischen Transaktivistin Diva, die Cilins auf YouTube gefunden hat. Da er selbst kein Vietnamesisch spricht, musste er sich auf seinen vietnamesischstämmigen australischen Partner Dustin Dong verlassen, um die Bilder zu verstehen. Der Film ist deshalb in enger Kollaboration mit Dustin entstanden, der 15-Stunden Rohmaterial übersetzt und untertitelt hat.

Der Film beruht maßgeblich auf den Untertiteln, die die verschiedenen Ebenen der Kollaboration versinnbildlichen, indem sie die YouTube-Ästhetik im Film beibehalten. Nicht ohne eine gewisse Verwirrung zu verursachen, wird Dustin im Laufe des Films sogar selbst zu einem Protagonisten, als in einer zusätzlichen Untertitelspur, die diesmal oben im Bild erscheint, Colins die Entstehung des Films und Dustins Rolle erklärt. Als Diva aus der Öffentlichkeit verschwindet, wird Dustins Familiengeschichte, insbesondere die Beziehung zwischen seinen getrennten Eltern, in dieser zweiten Untertitelspur erzählt. Das Experimentieren mit den Untertiteln erlaubt eine Mehrstimmigkeit und einen Dialog zwischen den verschiedenen Akteur:innen des Films und aktiviert die Zuschauer:innen, die die Informationen selbst anordnen müssen.
Beeinflusst von der Video– und sozialen Medienästhetik brechen die Filme „Diva“, „Vlog #8998“ und „Uma ficção inútil“ mit einer Auffassung des Untertitels als nicht-filmische Form und betrachten sie vielmehr als Komponente des Bilds. Dabei fungieren die Untertitel nicht nur als Übersetzungsmittel, das im Vergleich zur gesprochenen Sprache jahrelang als mangelhaft betrachtet wurde, sondern vielmehr als Werkzeuge des Experimentierens, Zusammenarbeitens, Kommentierens, der kulturellen Vermittlung und subjektiven Erfahrung.
Marion Biet ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Goethe Universität Frankfurt. Sie ist außerdem Doktorandin im DFG-Graduiertenkolleg „Das Dokumentarische. Exzess und Entzug“ an der Ruhr-Universität Bochum mit einer Dissertation, die sich mit dem Effekt der longue durée auf die Darstellung des Lebens im Langzeitdokumentarfilm befasst.
1 Alle zitierten Protokolle sind bei der Erstnennung des entsprechenden Filmes verlinkt.
2 Vgl. Ivarson, Jan. „The history of subtitles in Europe“. In: Fong, Gilbert C. F. (Hg.). Dubbing and Subtitling in a World Context. The Chinese University Press, 2010. S. 3-12.
3 Vgl. Dwyer, Tessa & Lobato, Ramon. „Informal Translation, Post-Cinema and Global Media Flows.“ In: Hagener, Malte; Hediger, Vinzenz; und Strohmaier, Alena (Hg.). The State of Post-Cinema: Tracing the Moving Image in the Age of Digital Dissemination. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan, 2016. S. 127–45.
